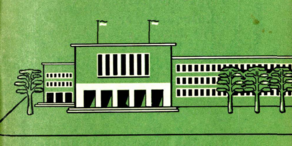Große Beteiligung der Fakultät auf internationaler Konferenz AAATE in Nikosia
- Startseite
- Vorträge
- TIP-Cluster

Künstliche Intelligenz, digitale Barrierefreiheit und Mensch-Computer-Interaktion - das waren einige der bestimmenden Themen der 30. AAATE. Mit mehr als 200 Vorträgen bot die Konferenz einen internationalen Begegnungs- und Austauschpunkt für Inklusionsforschende an der Schnittstelle zu assistiven Technologien. Eine Forschungsgruppe aus fünf Forschenden der TU Dortmund und zwei Partnerinnen aus gemeinsamen Projekten stellten Ergebnisse aktueller Forschungsprojekte vor.
Vertr.-Prof. Dr. Susanne Dirks moderierte die vom TIP-Forschungscluster organisierte Special Topic Session “Advanced Technologies for Inclusion and Participation in Education and Labour”. Mit insgesamt 14 thematisch relevanten und spannenden Beiträgen aus ganz Europa war die Session in diesem Jahr über zwei Tage verteilt. Die vorgestellten Themen reichten von der digitalen Unterstützung von Studierenden mit Autismus-Spektrum-Störungen beim Übergang von der Schule in die Universität bis zum Einsatz von immersiven Technologien in der Berufsausbildung und IoT-Technologien in Förderschulen. Die Session war eine der am besten besuchten Sessions auf der Konferenz und es gab viele interessante Impulse und Diskussionen für die Vortragenden und Zuhörenden.
Vertr.-Prof. Dr. Susanne Dirks und Vertr.-Prof. PD Dr. Bastian Pelka stellten in ihrem Vortrag “Participatory Development of an AI-enabled Application for Translation into Plain Language.
Insights from KARLA – A German Research Project with People with Intellectual Disabilities” Ergebnisse aus der gemeinsamen Arbeit mit Marie-Chistin Lueg und Lukas Baumann im Projekt Karla vor. Dabei erarbeiten Menschen mit Behinderungen ein KI-gestütztes Tool, mit dem sich in komplexer Sprache verfasste Briefe in einfache Sprache übersetzen lassen. Susanne Dirks und Bastian Pelka diskutierten mit dem Fachpublikum die Methoden, mit denen sie Menschen mit Behinderungen partizipativ am Projekt beteiligten.
In ihrem Vortrag “Bridging the Digital Divide: Enhancing Internet Accessibility for Students with Special Needs via Application Easy Reading” zu den Projektergebnissen aus dem Projekt EVE4all fokussierte sich Vertr.-Prof. Dr. Susanne Dirks vor allem auf die Erkenntnisse zur Rolle der Zuverlässigkeit von komplexen technischen Systemen auf die Technologie-Akzeptanz und das Vertrauen in Förderschulen.
Im Projekt EVE4all wurden in gemeinschaftlicher Forschung der Fachgebiete Rehabilitationstechnologie und Rehabilitationssoziologie die Anwendungsmöglichkeiten des Easy Reading Frameworks in schulischen und außerschulischen Kontexten validiert. Weitere Informationen zum Projekt EVE4all und zu den Projektergebnissen sindhier zu finden.
Laura Wuttke stellte in ihrem Vortrag „Immersive Learning for Inclusive Workplaces: Evaluating Mixed Reality in Vocational Training for People with Neurodevelopmental Disorders“ die wissenschaftlichen Ergebnisse des Projekts EdAL MR 4.0 vor. Dabei ging es um den Einsatz von Mixed-Reality-Technologien in der beruflichen Bildung für Menschen mit Behinderungen. Im Projekt EdAL MR 4.0 wurden in den letzten dreieinhalb Jahren Lernanwendungen für die HoloLens 2 in drei Berufsfeldern – Friseurhandwerk, Küche und Logistik entwickelt und erprobt. Ziel ist es, durch interaktive Hologramme praxisnahes und ressourcenschonendes Lernen zu ermöglichen und so Motivation, Kompetenzaufbau und Teilhabe am Arbeitsmarkt zu fördern. Mehr Informationen zum Projekt sind hier einsehbar.
Dorothea Hayh stellte in ihrem Vortag “Technology and Trust: A Scoping Review of AI-enabled Orientation & Mobility Technologies for Blind and Visually Impaired Individuals” vor, welche Faktoren das Vertrauen von Menschen mit Sehbeeinträchtigung oder Blindheit in KI-gestützte assistive Technologien zur Unterstützung der Orientierung & Mobilität beeinflussen. Sie beleuchtete sowohl die rehabilitationswissenschaftliche Perspektive als auch die technische Perspektive, welche einen Überblick über die bereits verfügbaren Funktionen der Technologien gab. Der technologische Überblick entstand in Kollaboration mit Siny Joseph der Kansas State University. Somit stellt das präsentierte Paper eine interdisziplinäre Verknüpfung beider Forschungsfelder vor, um die Berücksichtigung von Vertrauensmechanismen in künftigen Forschungen und Entwicklungen voranzubringen. Eine Kurzfassung des Artikels, der in einer Ausgabe der Fachzeitschrift “Technology and Trust” erschien, ist verfügbar in der frei zugänglichen Sammlung der Kurzartikel der Konferenz. Ein besonderer Dank gilt Dr. Susanne Dirks und Dr. Max Pascher für die sehr unterstützende Betreuung der Masterarbeit, welche den Grundstein für die Veröffentlichung sowie den Konferenzbeitrag legte.
In ihrem Vortrag über das Thema „Exploring Chatbot Development Using No-Code Platforms By People with Disabilities for Their Peers at A Sheltered WorkShop in Germany“ berichtete Sara Hamideh Kerdar von einer Studie, die im Rahmen eines Projekts der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) durchgeführt wurde. Dabei erhielten Beschäftigte mit kognitiven und Entwicklungsbeeinträchtigungen eine Schulung zur Nutzung einer No-Code-Plattform, um Chatbots zu entwickeln, die speziell auf die Bedürfnisse ihrer Werkstatt für behinderte Menschen (WfbM) angepasst waren. Die entwickelten Chatbots wurden anschließend in der Werkstatt implementiert, und es wurde Feedback von verschiedenen Stakeholdern zu unterschiedlichen Zeitpunkten eingeholt.
Den vollständigen Artikel sowie weitere Veröffentlichungen des Projekts finden Sie hier.